|
Wie gestaltet sich Fürsorge in SchuMaS-Schulen? Einblicke in armutsbezogene Fürsorge-Interaktionen zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen
Karst, Karina
;
Yendell, Oscar
;
Claus, Carolina

|
Dokumenttyp:
|
Präsentation auf Konferenz
|
|
Erscheinungsjahr:
|
2025
|
|
Veranstaltungstitel:
|
GEBF-Tagung 2025, 12. Jahrestagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung „Bildung als Schlüssel für gesellschaftliche Herausforderungen: Interdisziplinäre Beiträge aus der Bildungsforschung"
|
|
Veranstaltungsort:
|
Mannheim, Germany
|
|
Veranstaltungsdatum:
|
27.-29.01.2025
|
|
Verwandte URLs:
|
|
|
Sprache der Veröffentlichung:
|
Deutsch
|
|
Einrichtung:
|
Fakultät für Sozialwissenschaften > Unterrichtsqualität in heterogenen Kontexten (Karst 2023-)
|
|
Fachgebiet:
|
370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen
|
|
Abstract:
|
In Deutschland empfangen knapp zwei Millionen Kinder Transferleistungen (Bürgergeld), deren Lebenssituation folglich als „arm“ bezeichnet werden kann (Bundesagentur für Arbeit, 2023; Goebel & Krause, 2018). Zur Finanzierung schulischer Bedarfe (bspw. Schulmaterialien oder Mittagessen) können Schüler*innen im Transferleistungsbezug zusätzlich „Leistungen für Bildung und Teilhabe“ beantragen (Kaps & Marquardsen, 2017). Einem relationalen Verständnis von Armut folgend, führt der Empfang entsprechender Leistungen zu einem „empfangenden“ Verhältnis gegenüber einer „gebenden“ Gesellschaft und einer entsprechend öffentlichen Zuschreibung als „arm“ (Fritsch & Verwiebe, 2018). Praktisch zeigt sich dieses Verhältnis in Schule, indem Lehrer*innen armutsbetroffene Schüler*innen und ihre Familien in der Finanzierung beispielsweise für Mittagsverpflegung oder Schulmaterialien unterstützen, wodurch die Armut der Schüler*innen in die Interaktionen zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen hineingetragen wird (Kaluza & Schimnek, 2023; Steiner et al., 2024). Die innerschulische Prävention von Armutsfolgen ist jedoch nicht alleinig Aufgabe von Lehrer*innen, vielmehr werden auch weitere Professionen adressiert (bspw. Schulsozialarbeit), wodurch ein (idealtypisch) multiprofessionelles Vorgehen entsteht (Gigerl & Breser, 2024; Steiner et al., 2024). Theoretisch können Interaktionen zur Prävention von Armutsfolgen als individuelle fürsorgliche Praktiken gefasst werden, indem Lehrer*innen auf die Angewiesenheit entsprechender Schüler*innen reagieren (Dietrich, 2024). Diese Praktiken umfassen vier Phasen: 1. Die Wahrnehmung eines Fürsorgebedarfs, 2. Die Übernahme von Verantwortung für Fürsorge, 3. Konkrete Fürsorge-Interaktionen, 4. Die Reaktion der Fürsorge empfangenden Person (Tronto, nach Dietrich, 2024). Bisher ist jedoch unbeleuchtet, wie sich konkrete Fürsorge-Interaktionen zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen in Bezug auf den Bürgergeldbezug von Schüler*innen gestalten und somit zu den klassisch unterrichtsbezogenen und pädagogischen Tätigkeiten hinzustoßen. Gleichzeitig ist unklar, ob und wie Lehrer*innen sich für entsprechende Tätigkeiten überhaupt in der Verantwortung sehen.
Fragestellung:
In einer ersten Fragestellung wird daher untersucht, wie sich aus der Perspektive von Lehrer*innen Bürgergeld-bezogene Fürsorge-Interaktionen zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen gestalten. Damit verbunden wird der Frage nachgegangen, wie Lehrer*innen sich für diese Fürsorge in der Verantwortung sehen.
Methode:
Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden von Juni bis November 2023 acht Fokusgruppen mit jeweils 3-4 Lehrer*innen derselben Schule geführt (Barbour, 2018). Die Fokusgruppen wurden an drei weiterführenden SchuMaS-Schulen (ein Gymnasium, zwei Gemeinschaftsschulen) in verschiedenen Großstädten geführt, an denen der Anteil an Schüler*innen mit Transferleistungsbezug zwischen 30-85% variierte. Die Fokusgruppen wurden nach der Grounded Theory ausgewertet, indem beginnend offen in den einzelnen Fokusgruppen, anschließend axial und fokusgruppenübergreifend und abschließend selektiv kodiert wurde (Strauss & Corbin, 1998).
Ergebnisse und ihre Bedeutung:
Es wird gezeigt, dass Lehrer*innen bürokratische Fürsorge-Interaktionen zwischen Schüler*innen, Familien und Behörden (Jobcenter) gestalten, indem sie Schüler*innen und deren Familien im Bürgergeldbezug in der Beantragung von Mitteln für „Bildung und Teilhabe“ unterstützen (bspw. zur Finanzierung von Nachhilfe oder Mittagsverpflegung). Diese Interaktionen variieren zwischen den Schulen, indem es in einigen Schulen konkrete Lehrer*innen als Ansprechpartner*innen oder im Kollegium abgesprochene (digitalisierte) Abläufe gibt, während Abläufe und Zuständigkeiten in anderen Schulen ungeklärt bleiben. Wenngleich alle Lehrer*innen einen entsprechenden Fürsorgebedarf wahrnehmen, nehmen sie eine unterschiedliche Verantwortung für eben jene wahr. Einige Lehrer*innen dienen für Schüler*innen und ihre Familien als erste Ansprechpartner*innen für bildungsbezogene behördliche Fragestellungen und unterstützen sie in der Finanzierung schulischer Bedarfe, die ungenügend über „Bildung und Teilhabe“ abgedeckt werden. Andere Lehrer*innen weisen diese Verantwortung von sich und argumentieren, dass eine entsprechende Unterstützung belastend sowie Aufgabe von Behörden oder Schulsozialarbeit sei. Durch die unterschiedlichen Verantwortungsübernahmen gestalten sich nicht nur zwischen den Schulen, sondern auch innerschulisch Fürsorge-Interaktionen unterschiedlich.
Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund diskutiert, wie sich die unterschiedliche Verantwortungsübernahme der Lehrer*innen auf die vier Phasen von Fürsorge-Interaktionen auswirkt (Dietrich, 2024). Zudem wird diskutiert, inwiefern ein multiprofessionelles Vorgehen zu einer kohärenten innerschulischen Prävention von Armutsfolgen beitragen kann (Gigerl & Breser, 2024; Steiner et al., 2024).
|
 | Dieser Eintrag ist Teil der Universitätsbibliographie. |
 Suche Autoren in Suche Autoren in
Sie haben einen Fehler gefunden? Teilen Sie uns Ihren Korrekturwunsch bitte hier mit: E-Mail
Actions (login required)
 |
Eintrag anzeigen |
|
 ORCID: 0000-0001-9976-6265 ; Yendell, Oscar
ORCID: 0000-0001-9976-6265 ; Yendell, Oscar  ORCID: 0000-0001-9432-0328 ; Claus, Carolina
ORCID: 0000-0001-9432-0328 ; Claus, Carolina  ORCID: 0000-0003-0752-8564
ORCID: 0000-0003-0752-8564





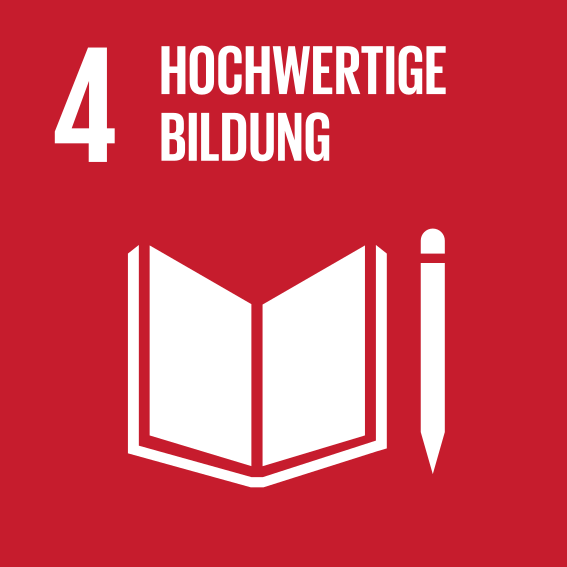

 Suche Autoren in
Suche Autoren in